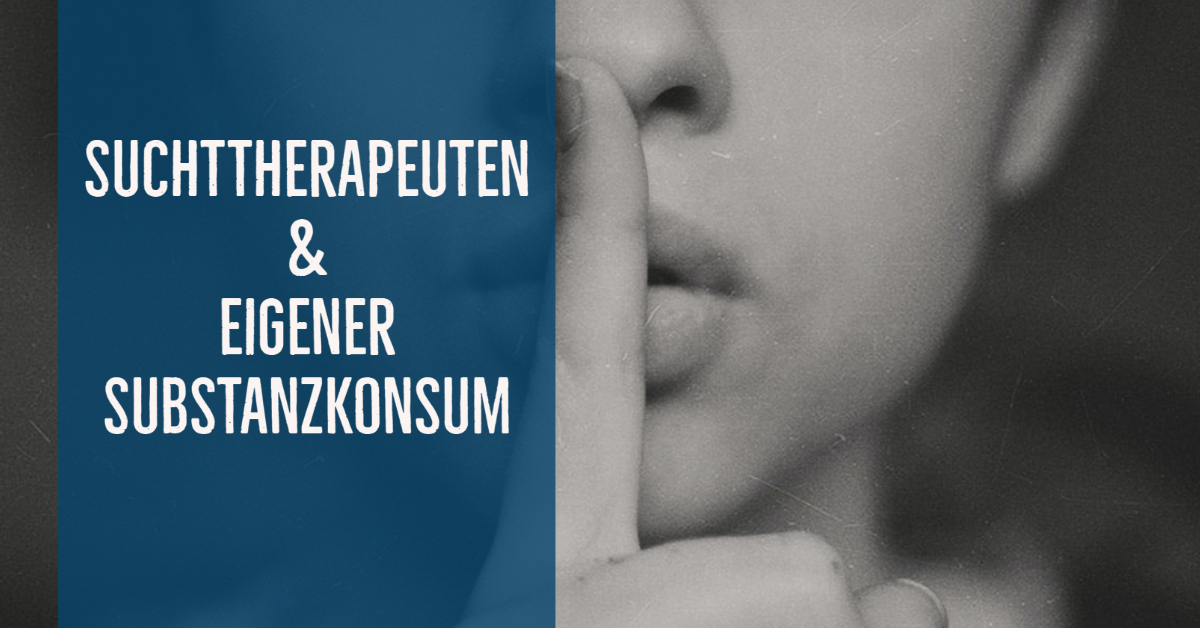In der Suchthilfeforschung gibt es noch viele Tabus: Therapeuten¹, die in abstinenzorientierten Einrichtungen arbeiten, aber Abstinenz innerlich als alleiniges Therapieziel ablehnen; Therapeuten, die sich in ihre Patientinnen verlieben und die therapeutische Distanz nicht mehr wahren oder noch mehr; der eigene Konsum von Substanzen durch Suchttherapeuten. Dies ist nur eine kleine Auswahl, die zeigt, wie viel hier noch zu beforschen und zu klären ist.
Inhaltsübersicht
Neugierige Klientenfragen
Das letztgenannte Thema möchte ich hier aufgreifen: Substanzkonsum (Alkohol, Nikotin, Cannabis usw.) und andere potentiell suchterzeugende Verhaltensweisen, z.B. in den Bereichen Glücksspielsucht, Kaufsucht und Mediensucht, bei Fachkräften der Suchthilfe. Praktiker kennen das Thema, weil sie immer wieder von ihren suchtkranken Klienten darauf angesprochen werden: „Haben Sie auch schon mal Drogen genommen?“, „Trinken Sie nach Feierabend Bier?“, „Wie halten Sie es mit dem Alkohol im Karneval?“, „Sie haben doch bestimmt auch schon mal zu viel getrunken.“ usw.
Dass Klienten neugierige Fragen stellen und wissen wollen, mit wem sie es hintergründig zu tun haben, ihre Therapeuten testen wollen, ist erlaubt und gehört zum Repertoire, mit dem ein Suchttherapeut umgehen können muss. Aber wie steht es tatsächlich um den Substanzkonsum von Suchttherapeuten? Daten zur psychischen Gesundheit von Suchttherapeuten sind inzwischen durchaus bekannt. So eruierten Wortberg et al (2012) sowie Kuhn et al. (2018)², dass Suchttherapeuten geringere Werte für Depressionsneigung und Neurotizismus aufwiesen. Es handelte sich dabei um eine große, aber nicht repräsentative Untersuchungsgruppe von 245 bzw. 123 Fachkräften. Jedoch wurden keine Maße für den gegenwärtigen oder früheren Substanzkonsum der Suchttherapeuten erhoben.
Der Substanzkonsum von Suchttherapeuten als Tabuthema in der Szene?
Die Berufsfeldforschung gibt zum Eigenkonsum von Suchttherapeuten bislang wenig her. Man kann schnell den Eindruck gewinnen, dass es sich bei dem Thema um ein besonderes Tabuthema handelt. Und dies bei den psychosozialen Berufen (Soziale Arbeit, Psychologie) noch mehr als bei den medizinischen (Medizin, Pflege). Denn bei den letztgenannten liegen eine ganze Reihe kritischer Fachbeiträge vor, insbesondere im Deutschen Ärzteblatt:
- https://www.aerzteblatt.de/archiv/47553/Suchterkrankungen-bei-Aerzten-Bei-Therapie-gute-Aussicht-auf-Heilung
- https://www.aerzteblatt.de/archiv/139428/Suchterkrankungen-bei-Aerzten-Sanktionieren-und-Helfen-sind-kein-Widerspruch
- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-37117-2_16
- https://www.aerztezeitung.de/Panorama/Alkohol-Cannabis-und-Co-wenn-Aerzte-suechtig-werden-223796.html
- https://ichbinarzt.de/aerzte-und-sucht-drogen-alkohol-medikamente/
Aus diesen Beiträgen werden die besonderen Risiken medizinischen Fachpersonals für missbräuchlichen Substanzkonsum deutlich. Diese ergebe sich aus dem oft hohen Stresslevel in der Alltagsarbeit genauso wie aus der geringeren Griffnähe gegenüber psychoaktiven Substanzen. Während medizinisches Fachpersonal sich dem Thema der Suchtgefahren in den eigenen Reihen also immer wieder stellt, ist es unter Suchttherapeuten fast vollständig tabuisiert.
Gründe der Tabuisierung
In Rahmen einer akademischen Master-These beschäftigte sich eine Absolventin (Master-Studiengang Suchthilfe/Suchttherapie, KatHO NRW, Köln) unlängst mit dem Thema des eigenen Substanzkonsums bei Suchttherapeuten. Dabei wurden zwar nur sieben Fachkräfte interviewt, so dass keine Generalisierung möglich ist. Auffällig ist an dieser Studie jedoch, dass fast alle Fachkräfte (weiblich und männlich) ein Schamgefühl in Bezug auf ihren eigenen, unproblematischen Substanzkonsum berichteten. Besonders bezieht sich das auf Cannabiskonsum, der für die meisten ein experimentelles Durchgangsstadium im Jugendalter darstellte. Wen wundert es?! Aber dass sie dafür heutzutage – oft viele Jahre später – ein schlechtes Gewissen und Schuldgefühle aufweisen, finde ich sehr bemerkenswert. Es gibt da offenbar etwas zu verarbeiten!
Substanzkonsum – von genussvoll, normal, exzessiv, erlaubt, illegalisiert, funktional bis süchtig
Es gibt verschiedene Formen des Substanzkonsums von genussvoll bis süchtig und viele verschiedene Substanzen. So weit ist es trivial! Dass Suchttherapeuten sich implizit ihres Substanzkonsums schämen, kann vor allem zwei Ursachen haben:
(1) Sie machen falsche Angaben darüber, konsumieren in Wirklichkeit mehr und haben ein Problem mit Menge und Kontrolle. Diese Variante halte ich für die Mehrheit nicht zutreffend. Woher sollte ein solches umfassend breites Problem kommen? Es würde im Berufsalltag auf die längere Sicht auffallen.
(2) Sie denken und fühlen implizit, dass sie sich ihres Substanzkonsums schämen sollten und verstecken es deshalb. Dabei könnten und sollten sie offen damit umgehen, weil es im Grunde kein verheimlichungswürdiges Problem darstellt und außerdem ein Modellverhalten für ihre Klienten sein könnte, insoweit diese nicht abstinent werden wollen (also reduzierten Konsum lernen wollen) oder ganz allgemein hinsichtlich Echtheit und Authentizität.
Leider praktizieren etliche Suchttherapeuten dies scheinbar nicht so selbstbewusst und offen, wie es vorteilhaft wäre. Die Verheimlichung des eigenen Konsums oder der Konsumgeschichte, nicht der Konsum an sich, ist das Problem! Denn es schafft Barrieren und Hemmungen, die von Klienten durchaus wahrgenommen werden können. Woher kommen diese Hemmungen, gegenüber den suchtkranken Klienten, in dieser Hinsicht offen zu sein?
Scham als isomorpher Trigger für Beschämung bei Suchttherapeuten
Ich gehe von einem unbewussten emotionalen Prozess aus, der Suchttherapeuten dazu bringt, ihre eigene Konsumgeschichte und ihren aktuellen Substanzkonsum vor den Klienten zu verschleiern oder zu verheimlichen. Hintergrund dafür bietet das für alle Suchtkranken zentrale Gefühl der Scham in Bezug auf ihr eigenes Verhalten, immer mehr die Kontrolle über sich zu verlieren. Das diesbezügliche Schamverhalten führt zu Abwehr, Aufmerksamkeitsablenkung und weiteren kognitiven Verzerrungen, alles nur um das Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten. Suchttherapeuten stoßen in der täglichen Arbeit immer wieder auf die enorme Abwehrkraft dieses schamgetriggerten Grundkonflikts von Suchtkranken.
Dass sie bei der Begegnung mit Suchtkranken ihren eigenen Substanzkonsum und ihre diesbezügliche Geschichte dann in manchen Fällen – leider ist bislang nicht bekannt wie oft dies geschieht – schamhaft verstecken, kann als unbewusste Reaktion auf diesen Grundkonflikt der Suchtkranken verstanden werden. Dabei wäre das Gegenteil adäquat: Die eigene Geschichte und den Umgang mit Suchtmitteln selbstbewusst als Beispiel der gelingenden Kontrolle nutzen. Das schamhafte Verstecken der eigenen Geschichte kann als gleichgestaltige unbewusste Reaktion auf das Dilemma des Suchtkranken verstanden werden – eine isomorphe Reaktion, bei der das eigene Schamgefühl als Trigger fungiert.
Und sonst?
Nun wird man zu Recht einwenden, dass Suchttherapeuten noch andere Gründe haben, mit ihren Klienten nicht über ihren eigenen Substanzkonsum sprechen zu wollen als ihn aus Schamgefühl verheimlichen zu müssen. Und das ist auch sicher richtig und zeigt die Vielschichtigkeit des Problems. Suchttherapeuten können schlichtweg denken, dass es ihre Klienten nichts angeht, was sie früher konsumiert haben oder wie sie es heutzutage mit dem Konsum halten. Es könnte auch als therapeutisch kontraproduktiv angesehen werden, darüber mit Klienten zu reden. Manche Suchttherapeuten berichteten auch, dass sie nicht öffentlich ein BTMG-Delikt (vor allem Besitz von Cannabis) zugeben wollten, auch wenn sie in der Vergangenheit nur kleine Mengen (sogenannter Eigenbedarf) erworben hätten. Schließlich kann ein Suchttherapeut in Klientenfragen bezüglich des Substanzkonusms von Therapeuten auch ein Abwehrverhalten in Bezug auf die eigene Sucht erkennen. Dies will der Therapeut dann nicht mit Auskünften bedienen, um dem Klienten diesbezüglich nicht eine Vermeidung relevanter Therapiethemen zu ermöglichen.
Diese Varianten im Umgang mit dem eigenen Substanzkonsum im Kontext der Therapie mit Suchtkranken mögen auch alle ihre Berechtigung aufweisen, sind aber doch wenig therapieförderlich. Sie begünstigen nämlich eine Verschleierung des eigenen Verhaltens, welche für die therapeutische Beziehung auf Dauer nicht günstig sein dürfte. Und dies wissen Suchttherapeuten, was ein Grund dafür sein wird, dass sie aufgrund solcherlei Motive ihren Substanzkonsum nicht verbergen.
Drei Ratschläge für Suchttherapeuten: Vorbereitet sein, authentisch bleiben, nicht in die Defensive geraten!
Entscheidend im Therapieprozess ist, dass der Suchttherapeut auf diese Situationen mit Klienten vorbereitet ist und sich zu verhalten weiß. Dabei ist es wichtig, nicht in die Defensive zu geraten, also etwa sich für den eigenen Substanzkonsum rechtfertigen zu wollen oder gar müssen. Und dann sollte das eigene Verhalten obendrein authentisch und echt sein, weil Klienten spüren, wenn es anders ist. Und deshalb frage ich mich am Ende wieder, wenn Suchttherapeuten ihren Eigenkonsum tabuisieren, welche unbewusste Motivation dem zugrunde liegt. Da es leider noch nicht genug Forschung zu diesem schwierigen Thema gibt, plädiere ich – vorläufig – dafür, dass es vor allem Effekte im Bereich des isomorphen Beschämens – sich unbewusst so zu fühlen, wie dies die eigenen Klienten tun – sind, die zu den oft seltsamen Scham- und bisweilen auch Schuldgefühlen führen.
Dabei könnte der reflektiert konsumierende Suchttherapeut seinen eigenen Konsum und seine Geschichte damit in der Therapie mit Klienten konstruktiv nutzen, z.B. als Methode für gelungene Selbstkontrollprozesse. Dabei lohnt natürlich auch ein Blick auf andere potentiell süchtig machende Verhaltensweisen: Glücksspiel, Arbeiten, Essen, Kaffeetrinken, Medien, Kaufen usw. Ich erwähne diese Punkt nicht, um zu moralisieren, sondern um die Sensibilität für die eigenen Anteile in Richtung Exzessivität, Zwanghaftigkeit und Impulskontrollverlust zu stärken. Suchtprozesse sind schließlich in der modernen Konsum- und Medienwelt allgegenwärtig. Nicht Moral ist das Problem, sondern die Allverfügbarkeit der Substanzen und Medien.
Ex-User prägten früh den moralischen Anspruch an Suchttherapeuten
Die Geschichte der Drogentherapie in Deutschland war in den Anfangsjahren – von 1970 bis etwa 1990 – sehr stark vom Ex-User-Modell beherrscht. Drogenabhängige, die durch eine Therapie oder sonst wie clean geworden waren, übernahmen die Arbeit, noch konsumierende Abhängige zur Abstinenz zu führen. Dies geschah meistens in kleineren therapeutischen Wohngemeinschaften, in denen die Ex-User und die Klienten eng zusammenlebten. Martin Schmidt³ (2003) beschrieb diese Phase in seiner Dissertation ausführlich. Nach und nach wurde dieses Modell der Drogentherapie in Deutschland erschwert, insbesondere durch die Qualifikations- und Weiterbildungsanforderungen der Leistungsträger.
Es gab also kein Geld mehr für die anfangs so alternativlose Therapie durch Ex-User. Entweder sie qualifizierten sich weiter zu Sozialarbeitern und Sozialtherapeuten oder sie hatten keine Chance mehr in der sozialversicherungsfinanzierten Suchtreha-Szene. Nur wenige therapeutische Gemeinschaften – wie Release und vor allem Synanon – überlebten, die nie mit den Sozialleistungsträgern zusammenarbeiteten, sondern völlig auf Selbsthilfe und Gemeinschaft bauten. In diesen Gruppen war der Anspruch an den Substanzkonsum (bis auf Nikotin und bisweilen auch Alkohol) völlige Abstinenz. Der Ex-User war Modell für den Noch-Konsumierenden hinsichtlich Bewältigung der Sucht durch gelebte Abstinenz. Nicht überraschend also, dass dadurch ein hoher moralischer Anspruch der Glaubwürdigkeit und Enthaltsamkeit in der Drogentherapieszene entstand. Auch heute arbeiten noch vereinzelt abstinent lebende Drogenabhängige mit akademischer und suchttherapeutischer Qualifikation in der Suchttherapie. Ohne dass verlässliche Zahlen dazu vorliegen, würde ich ihren Anteil innerhalb der gesamten ambulanten und stationären Suchttherapie auf ca. 5% schätzen.
Arbeitsfeld Sucht: Von außen betrachtet deutlich anders als von innen
Die Berufsfeldforschung zur Suchthilfe zeigt noch ein weiteres interessantes Phänomen. Die Berufszufriedenheit derer, die mindestens mittelfristig (i.d.R. mindestens 2 Jahre) in der Suchthilfe verbleiben, ist dann auf Dauer recht hoch. Dies wird normalerweise mit den intensiven Beziehungen zu den Klienten, den Herausforderungen des Themas und der relativen Gestaltungsfreiheit der eigenen Tätigkeit, vor allem im ambulanten Bereich, begründet. Die „Außenwelt“ – auch innerhalb der Berufsgruppen Medizin, Psychotherapie und Soziale Arbeit – hält jedoch das Stereotyp vom unattraktiven Arbeitsfeld „Sucht“ aufrecht. Dies wird mit den vermeintlich geringen Erfolgen in der Tätigkeit, den vielen frustrierenden Erlebnissen mit Suchtkranken und der stressreichen Behandlung begründet.
Insofern ist die Diskrepanz zwischen Binnen- und Außensicht in der Suchthilfe ein bemerkenswertes Charakteristikum des Arbeitsfeldes, was uns zum nächsten Thema führt. Dabei ist es am meisten der Zufall, der Menschen zu Suchttherapeuten macht. Von allen relevanten Einflussfaktoren – soziales Engagement für Benachteiligte, suchtkranke Eltern, fachliches Interesse usw. – ist und bleibt, wie die Berufswahlforschung immer wieder zeigt, Zufall die mächtigste Konstante, die Menschen zu dem machen, was sie im Beruf finden.
Co-Stigmatisierung
In Anbetracht des wenig realistischen Blicks vieler Nicht-Experten für die Suchthilfe auf das Tätigkeitsfeld verwundert es nicht, dass auch in anderen Hinsichten Vorurteile und Zuschreibungen vorherrschen, die wenig mit der Realität in den verschiedenen Feldern der Suchthilfe zu tun haben. Es kann fast von einer Co-Stigmatisierung der Fachkräfte der Suchthilfe ausgegangen werden. Darunter ist zu verstehen, dass ihnen ähnliche Eigenschaften wie den Suchtkranken selbst – wenigstens implizit – zugeschrieben werden.
Auch wenn dieses Phänomen in der Realität sicherlich heterogener ausfällt, als es auf den ersten Blick erscheinen mag, führt die Idee der Co-Stigmatisierung zu einigen interessanten Konsequenzen: Da die Suchtkranken zu den am stärksten stigmatisierten Gruppen in der Bevölkerung insgesamt gehören und dies auch auf ihren Status innerhalb der verschiedenen Gruppen psychisch Kranker zutrifft, verwundert es nicht, dass auch die mit ihnen tätigen Fachkräfte ähnlich unrealistisch und verzerrt gesehen werden (siehe letzten Abschnitt). Sie werden von Zuschreibungen getroffen, die – in ähnlicher Form – der stigmatisierten Gruppe an sich gelten. Dass dies zu einem Sonderstatus in den verschiedenen Fachdisziplinen – Psychiatrie, Psychotherapie, Klinische Sozialarbeit – führt, mag dann nicht mehr verwundern. Vom Sonderstatus ist es dann nicht mehr weit bis zum Sonderversorgungsbereich, als den die Suchthilfe seit langem gilt.
Fazit
Es ist ein weiter Bogen vom Eigenkonsum der Suchttherapeuten bis zur Suchthilfe als Sonderversorgungsbereich. Wichtig erscheint mir, dass sich die Fachkräfte in der Suchthilfe weiter von alten Tabus und Mythen entfernen und sich innovativen Ideen und Konzepten gegenüber öffnen. Das wird die Effektivität und Evidenzbasierung der Suchthilfe stärken und den Weg von der „Konfession zur Profession“ stärken. Hierzu gehört auch der offene Umgang mit dem eigenen Konsum, der sich auch in Expositionstrainings mit reduktionsbereiten Klienten nutzen lässt. Bei abstinenzbereiten Klienten sind Authentizität und Echtheit der Suchttherapeuten von entscheidender Bedeutung. Hintergründig geht es aber um den Abbau impliziter Schamgefühle und deren proaktiver Nutzung für die Suchttherapie: Übertragungen und Gegenübertragungen erkennen und nutzen.
¹ In diesem Beitrag wird durchgängig die generisch maskuline Form verwendet. Wegen der besseren Lesbarkeit. Gemeint sind stets weibliche und männliche Personen.
² Wortberg, S., Kuhn, U. & Klein, M. (2012). Soziale Arbeit in der Suchthilfe – Ergebnisse zweier empirischer Studien zum Berufsfeld. Suchttherapie 13, 167 – 174. Kuhn, U., Graß, J. & Klein, M. (2018). Aktuelle Ergebnisse aus der vergleichenden Berufsfeldforschung: Psychische Belastungen und Burnoutrisiken im Handlungsfeld der Suchthilfe. Suchttherapie 19, 39 – 45.
³ Schmidt, Martin (2003). Drogenhilfe in Deutschland. Entstehung und Entwicklung 1970 – 2000. Frankfurt/M.: Campus Forschung.